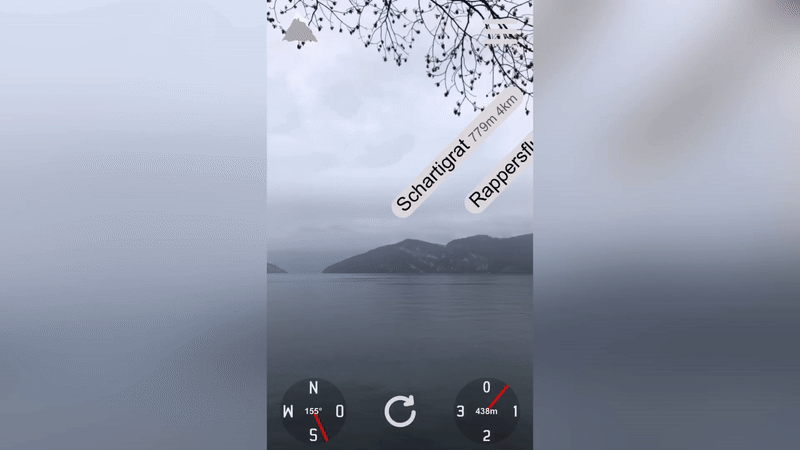Wer sich von einer Behörde ungerecht behandelt fühlt oder mit seinen Anliegen auf taube Ohren stösst, kann sich beschweren – zum Beispiel beim Ombudsmann oder der Ombudsfrau. Die Ombudsstelle der Stadt Zürich behandelte im vergangenen Jahr 1436 Fälle; die Hälfte davon war innert zwei Monaten erledigt. Eine Erfolgsgeschichte in 100 Sekunden: Mein neuer Beitrag auf Radio SRF 2 Kultur.